

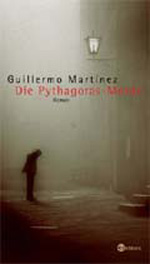

Mathematische Widerlegung des Serienkiller-Schwachsinns
____
Thomas de Quincey: Der Mord als eine schöne Kunst betrachtet; hrsg. u. bearbeitet von Gerhild Tieger
Guillermo Martínez: Die Pythagorasmorde; aus dem Spanischen von Angelica Ammar
Mord als feinste Mathematik betrachtet
Vermutlich hat sich noch kein Leser dieser Kolumne Gedanken darüber gemacht, wie schwer es eigentlich ist, eine Krimikolumne zu schreiben. Verstehe ich. Wer macht sich schon gerne jemand anderes Kopf? Aber beschweren, das können sie sich schon, die Leser. Hab ich den Namen von irgendeinem Kommissar oder Murkser falsch geschrieben, zack! hagelt es Protestmails. Den Lesern ist es zwar egal, ob man Mankell auf der ersten (richtig) oder der zweiten Silbe betont (falsch, machen aber 97 Prozent der Menschheit), wenn ich aber irgendein Detail aus einem Krimi, den ich vor zwei Monaten gelesen habe, unkorrrekt wiedergebe, etwa einen Hund als Katze, gibt es Saures.
Erst recht gibt es Zoff, wenn jemand glaubt, ich hätte irgend ein Etwas verraten. Als ich einmal in München bei einer öffentlichen Diskussion andeuten wollte, wie ein Tabor-Süden-Roman von Friedrich Ani ausgeht - ich wollte nur "gut" sagen, "gut geht er aus" - begannen in der ersten Reihe die Mädchen laut zu kreischen: Nein, Nein, Nichts verraten! und stopften sich die Zeigefinger in die Ohren.
Das Grundrecht des Lesers
Ich verstehe diese Begierde, unbedingt selber herausfinden wollen, wie es ausgeht, wer der Mörder ist, wie er es gemacht hat. Das ist ja die Crux. Jeder beliebige Roman-Kritiker darf herkommen und das ganze Werk beurteilen und ausführlich darlegen, warum er es "gelungen" (so reden manche tatsächlich) oder "verfehlt" findet. Ich aber darf über den Klappentext eigentlich nicht hinausgehen. - und jeder weiß, was das bei den heutigen Klappentexten bedeutet. Schreibe ich, der und der hat einen guten Krimi verfasst, darf ich das nicht begründen. Jedes Argument, das mein Urteil stützen könnte, darf nur so formuliert werden, dass ich das Grundrecht des Lesers, seinen Krimi selbst zu enträtseln, nicht verletze.
Das einzige Mittel, das ich anwenden darf, ohne berechtigte Interessen zu stören, ist der Vergleich. Aber auch da kann es hapern. Wenn ich z. B. behaupte, der und der schreibe wie Mankell, glaubt jeder sofort zu verstehen, was ich meine - nämlich das, was er über Mankell gehört hat oder weiß. Aber wenn ich die These wage, der Argentinier Guillermo Martínez habe erreicht, was dem Engländer Thomas de Quincey 1827 und 1839 mit seinem Essay über den Mord als eine der Schönen Künste betrachtet (so lautet die einzig korrekte Übersetzung des Titels) versagt blieb, nämlich die lose essayistische Form hinter sich zulassen, wird es nicht Zoff! geben, sondern Uff! heißen. Martínez' Pythagorasmorde sind zugleich ein Krimi und eine Poetologie des Kriminalromans und ein Essay über die Grenzen des menschlichen Verstehens überhaupt.
Martínez = Doyle (heute)
Wäre ich nicht schon fast am Ende meiner Kolumne angelangt, würde ich jetzt den ganzen Klappentext wiedergeben. So bleibt mir nur die unbeweisbare Behauptung: Guillermo Martínez ist ein neuer Conan Doyle. Holmes sagte über Indizien und Beweise: "Wenn man alles ausgeschaltet hat, was unmöglich ist, bleibt am Ende etwas übrig, das die Wahrheit enthalten muss, mag es auch noch so unwahrscheinlich sein." Der Oxforder Mathematiker Arthur Seldom - Held, Serlock Holmes und William von Baskerville der Pythagorasmorde - beginnt bei der Theoriebildung, also dort, wo Holmes drei Generationen zuvor mit der Beweiswürdigung aufgehört hat. Sein Wissenschaftlerleben hat Seldom darauf verwandt, den Unvollständigkeitssatz des Mathematikers Gödel zu beweisen, und zwar am Beispiel von Kriminaluntersuchungen. Jetzt, 1993 im Sommer, ist Seldoms Kombinationsfähigkeit akut gefordert. Die Hauswirtin seines argentinischen Schülers (der Ich-Erzähler und Watson des Romans, der, wie Martínez seinerzeit auch, ein Post-Doc-Stipendium als Mathematiker in Oxford hat), liegt erstickt auf dem Sofa. Seldom wurde mit einem Zettel an den Tatort gelockt, auf dem Zeitpunkt und Ort des Mordes vermerkt waren, der Text "Nummer eins in der Reihe" - und ein Kreis. Seine Studien über Serienkiller haben Seldom in der Auffassung bestärkt, "dass ein intellektuell motiviertes, sagen wir rein aus geistigem Profilierdrang begangenes Verbrechen, wie etwa bei Raskolnikow, oder der Mord als schöne Kunst im Sinne von Thomas de Quincey in der Realität nicht vorzukommen scheint."
Mathematische Widerlegung des Serienkiller-Schwachsinns
Was, so hat sich Martínez gedacht, zu beweisen wäre. Das gelingt ihm so verblüffend (Wir münden in die Behauptungsphase der Kolumne), dass selbst sein Ich-Erzähler sich erst zehn Jahre nach diesen Ereignissen zu ihrer intellektuellen Verarbeitung imstande sieht. Und Martínez' von Tempo, Anspielungsreichtum und philosophischer Raffinesse erschöpften Leser begreifen auch erst nach einer Weile, dass sie an der gelungensten mathematisch möglichen Widerlegung des laufenden Serienkillerschwachsinns und einem Revival des Rätselkrimis auf höchst elegantem Niveau teilgenommen haben. Zu viel verraten?
Unredigiertes Manuskript, Veröffentlichung in DIE ZEIT Nr. 11 vom 9. 3. 2005