

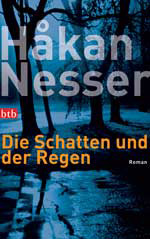
____
Håkan Nesser:
Die Schatten und der Regen
Aus dem Schwedischen von Christel Hildebrandt
Die langen Schatten der Vergangenheit
Soll ein Mord immer aufgeklärt werden? Ja, selbstverständlich.
Doch wenn man sich in die Einzelheiten vertieft, verdünnisieren sich
die guten Gründe, sie werden flüchtiger. Dem Opfer kann das
Leben nicht wiedergegeben werden. Die Verwandten der Ermordeten führen
oft den Wunsch nach Vergeltung an, wenn sie unnachgiebig die Todesstrafe
für den Täter fordern. Wer Leben nimmt, soll selbst nicht mehr
leben dürfen. Doch kann Vergeltung tatsächlich über den
Verlust eines Menschen hinwegtrösten? Und wie dringlich ist die Identifizierung
und Bestrafung eines Täters, wenn wie in Schweden Mord nach 25 Jahren
verjährt?
Auf solche Erwägungen stößt uns Håkan Nesser in
seinem jüngsten Roman Die Schatten und der Regen.
Doch bevor Nesser in seiner Erzählung auf die zentralen Fragen von
Mord und Schuld und Sühne zusteuert, fesselt er die Leser wie es
alle guten Erzähler tun, indem er sie so mit den Hauptfiguren vertraut
macht, dass sie nicht mehr von ihnen lassen können – und vor
allem: ihnen trauen.
Mörtberg kehrt zurück
Da ist zum einen der Ich-Erzähler David Mörtberg.
Der Lehrer hat sich für ein Jahr beurlauben lassen. Von Uppsala ist
er etwas widerwillig nach K. aufgebrochen, einer kleinen Stadt hoch im
schwedischen Norden, in der er seine Kindheit verbracht hat. (K. ist nicht
identisch mit Nessers Geburtsort Kumla, obwohl vieles an diesem Roman
auf Autobiographisches anzuspielen scheint: So lebt auch Håkan Nesser
in Uppsala, war bis 1998 Lehrer und ist 1950 geboren wie sein Erzähler.)
Anlass von Mörtbergs Reise in die Kindheit ist ein Brief seiner Schwester,
in dem sie ihm mitteilt, dass ihr alter Ziehbruder Viktor Vinblad nach
Jahrzehnten der Abwesenheit wieder nach K. zurückgekehrt ist. Doch
bevor wir zum anderen nach und nach erfahren, was es mit diesem Viktor
auf sich hat, werden wir in Mörtbergs skurrile Lebensumstände
eingeweiht. Er hat sich von seiner Frau und von seiner Geliebten getrennt.
weil sie beide eine Abmachung nicht eingehalten haben: Sie sind schwanger
geworden. Als ihn die Schwester wegen seiner Kaltherzigkeit empört
zur Rede stellt, lässt er beiläufig einfließen, dass er
einige Wochen vor dem Zeitpunkt der Empfängnis sterilisiert worden
war.
Viktor ist ein Mörderkind![]()
Diese kleine Groteske hätte uns warnen müssen. Doch erst zum
Schluss der verschlungenen Erzählung begreifen wir, dass das, was
dem alltäglichen Menschenverstand einleuchtend scheint, noch lange
nicht die Wahrheit sein muss. Der Weg zur Erkenntnis ist gepflastert mit
den Erinnerungen an eine Kindheit im hohen Norden: voller Zauber, voller
Rätsel und Grausamkeit. Denn Viktor ist ein Mörderkind. Sein
Vater hat die Mutter im Suff erschlagen und anschließend sich selbst
umgebracht. Mörtbergs Eltern nehmen das Waisenkind auf, und seitdem
sind die Schicksale der drei Kinder miteinander verknüpft.
Dieser Viktor, um den sich alles dreht, war einmal ein Pfundskerl. Er
konnte Psalmen rückwärts singen, vergaß nichts und fiel
als Fünfzehnjähriger, während er gerade dabei war, das
seit 328 Jahren ungelöste Rätsel um Fermats letzten Satz aufzudröseln,
aus dem Schulfenster. Nach dem Sturz verstummte er. Mit drei anderen Außenseitern
war er später auf einem Bauernhof zusammengezogen. Als die geistig
etwas zurückgebliebene Mitbewohnerin Sara nackt und erschlagen im
Wald gefunden wurde, verschwand er über Nacht und galt seitdem als
der Schuldige. Zwei Morde sind in den letzten fünfzig Jahren in K.
geschehen, und in beide war Viktor verwickelt. Jetzt sind mehr als 25
Jahre vergangen, der Mord ist verjährt, und Viktor ist von wer weiß
woher zurückgekehrt. Wird der Tod Saras aufgeklärt werden? Wie
soll Martin mit seinem Ziehbruder umgehen, wenn dieser jetzt den Mord
gesteht? Die Rückkehr Viktors erweist sich als Katalysator, doch
auf überraschend andere Weise, als man hätte vermuten können.
Nesser nimmt es ernst
Håkan Nesser ist ein Autor, der es mit beidem ernst meint, mit dem
Krimi und mit dem Roman. Wie sein deutscher Kollege Friedrich
Ani betrachtet er den Kriminalroman als eine Angelegenheit auf und
um Leben und Tod, als Struktur der erzählerischen Existenz- und Seelenforschung.
In diesem Fall, der keinen Ermittler und nur die skeptische Besinnung
einiger älter gewordener Menschen auf die Zufälle und Verstrickungen
ihrer Biografie kennt, bleiben keine losen Fäden über, wohl
aber einige Fragen offen. Gibt es für die Aufdeckung der Wahrheit
einen richtigen und einen falschen Zeitpunkt? Wie lebt man unter einem
Verdacht, von dem man sich unmöglich befreien kann? Was wird aus
einem Leben, das auf einer uneingestandenen Lüge beruht?
Unredigiertes Manuskript, Veröffentlichung in DIE ZEIT
Nr. 49 vom 1.12.05 ![]()